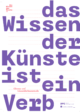Schriftenreihe des DFG-Graduiertenkollegs „Wissen der Künste“
De- und postkoloniale ästhetische Praktiken haben als Interventionen das Kunstfeld nachhaltig verändert und einen wichtigen Beitrag zu postkolonialer Kritik und dekolonialer Theorie-Praxis geleistet, indem sie Gegen-Narrative und Methoden der Erinnerung entwarfen und für die Sicht- und Lesbarkeit hegemonialer Strukturen sensibilisierten. Dennoch ist angesichts der fortgesetzten epistemischen Gewalt die Dekolonisierung der Künste ein unabgeschlossener und umkämpfter Prozess. Der Band fokussiert gegenwärtige künstlerische, ästhetische und epistemische Praktiken des Lernens und Verlernens und fragt nach den Konsequenzen dieser Wissenspraktiken für die Kunst- und Kulturwissenschaften, für die Institutionen der Kunst und für die Frage der Vermittlung von Kunst.