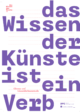Die Philosophie kennt den Zweifel als Methode: Indem alles dem Bewusstsein Gegebene aufgerufen und als Grundlage der Erkenntnis verworfen wird, gelangt das denkende Subjekt zu der unbezweifelbaren Gewissheit, dass es denkt. Eine solche erkenntnistragende Gewissheit spricht die Philosophie der Kunst und der ästhetischen Erfahrung ab. Dabei kennt auch die Malerei Zweifel an den sinnlichen Gegebenheiten, die sie nur scheinbar unbefragt ins Bild setzt. Der Beitrag folgt dem Bildzweifel als Verfahren künstlerischen Forschens und als Form eines sensiblen Wissens, das sich aus einem Exzess an Ungewissheit speist.
zweifeln